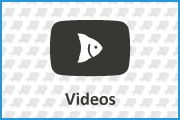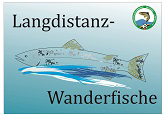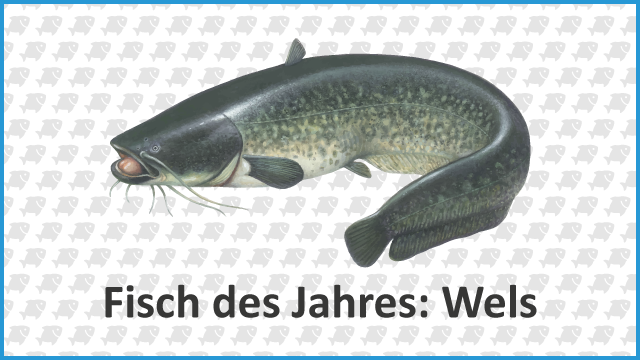Europäischer Wels ist Fisch des Jahres 2026
Mit seiner Wahl zum Fisch des Jahres 2026 rückt der Europäische Wels (Silurus glanis) in den Fokus von Naturschutz, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Der Deutsche Angelfischerverband e.V. (DAFV), das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Gesellschaft für Ichthyologie e.V. (GfI) möchten mit dieser Entscheidung auf eine faszinierende und zugleich umstrittene Fischart aufmerksam machen, die in vielerlei Hinsicht beeindruckt.
Gigant der heimischen Gewässer
Der Europäische Wels ist der größte einheimische Süßwasserfisch und kann Längen von bis zu drei Metern sowie Gewichte von über 150 Kilogramm erreichen. Als wärmeliebende Art profitiert er von den steigenden Wassertemperaturen im Zuge des Klimawandels und breitet sich zunehmend auch in Regionen aus, in denen er ursprünglich nicht vorkam.
Trotz seiner imposanten Erscheinung ist der Wels ein wichtiger Bestandteil gesunder Gewässerökosysteme. Er trägt durch das Fressen von Aas und kranken Fischen zur Selbstreinigung der Gewässer bei und übernimmt eine bedeutende regulatorische Funktion in Fischbeständen.
Ein Meister der Sinne
Der Wels besitzt eine schuppenlose, schleimige Haut mit einem empfindlichen System von Elektrorezeptoren, das ihm hilft, sich auch in trübem Wasser zu orientieren. Charakteristisch sind seine Barteln – zwei längere am Oberkiefer und vier kürzere am Unterkiefer –, mit denen er Beute und Artgenossen wahrnimmt.
Seine Ernährung ist vielseitig: Er frisst vor allem Fische, nimmt aber auch Insekten, Krebse, Schnecken und Frösche. Große Exemplare erbeuten gelegentlich sogar kleine Wasservögel oder Säugetiere. Welse kommunizieren untereinander über tieffrequente Laute und zeigen ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
Vom Donau-System bis in den Norden
Ursprünglich war der Europäische Wels vor allem im Donau- und Rheinsystem verbreitet. Heute findet man ihn dank menschlicher Einflüsse wie Besatzmaßnahmen und Kanalverbindungen nahezu in allen großen Flusssystemen Deutschlands – bis hin zu norddeutschen Seen und Flüssen.
Diese Ausbreitung hat jedoch auch ökologische Folgen: Außerhalb seines natürlichen Lebensraums kann der Wels heimische Fischarten verdrängen und das Gleichgewicht sensibler Lebensgemeinschaften stören. Besonders an Querbauwerken wie Wehren und Fischtreppen findet man Welse häufig, wo sie gezielt auf wandernde Fischarten wie Lachs, Meerforelle oder Maifisch jagen.
Der Wels in Sachsen-Anhalt
Auch in Sachsen-Anhalt ist der Europäische Wels inzwischen weit verbreitet. In der Elbe, in der Saale sowie in zahlreichen Stau- und Baggerseen hat er stabile Bestände aufgebaut. Besonders in den warmen Gewässerabschnitten der mittleren und unteren Elbe findet der Wels ideale Lebensbedingungen.
Für die heimischen Angler ist der Wels längst zu einer faszinierenden und respektierten Zielart geworden. Gleichzeitig stellen seine zunehmenden Bestände Fischereiverwaltung und Naturschutz vor neue Herausforderungen – etwa beim Schutz wandernder Fischarten oder beim Management von Fischgemeinschaften in kleineren Gewässern.
In Sachsen-Anhalt zeigt sich besonders deutlich, wie Klimawandel, Gewässernutzung und Artenmanagement ineinandergreifen: Während der Wels einerseits von höheren Wassertemperaturen profitiert, steht die ökologische Balance vieler Gewässer auf dem Prüfstand. Damit wird die Art zum Gradmesser für den Zustand und die Entwicklung unserer Fließ- und Stillgewässer.
Symbol für artenreiche Gewässer
Obwohl der Wels in Deutschland nicht gefährdet ist, steht seine Ernennung zum Fisch des Jahres 2026 symbolisch für den Schutz intakter und artenreicher Gewässer. Sie soll zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit dieser faszinierenden, aber auch polarisierenden Art beitragen.
In den Medien wird der Wels oft als „gefährlicher Räuber“ dargestellt – doch in Wahrheit ist er ein Paradebeispiel für die Anpassungsfähigkeit und ökologische Bedeutung unserer heimischen Fischfauna.
Der Beitrag des DAFV zum Fisch des Jahres findet sich unter folgendem Link:
https://dafv.de/projekte/fisch-des-jahres/der-europaeische-wels-ist-fisch-des-jahres-2026